Die meisten europäischen Demokratien sind zwar vergleichsweise stabil und weit besser als ihr Ruf, aber das Demokratie-Vertrauen der BürgerInnen verschlechtert sich zunehmend. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vor allem aber liegen sie in der Lücke zwischen den RepräsentantInnen und ihren WählerInnen. Die Möglichkeiten des Austauschs sind begrenzt. Manche PolitikerInnen agieren abgehoben und sehen jene, die sie repräsentieren, bestenfalls punktuell im Wahlkampf. Umgekehrt nutzen die BürgerInnen sehr selten die Möglichkeit, sich direkt an ihre Abgeordneten zu wenden. Um den Krisensymptomen ihren Schrecken zu nehmen, braucht es in erster Linie institutionelle Brücken zwischen Berufspolitik und Wahlvolk. Diese Brücken sind weit vielfältiger als ein geändertes Wahlrecht oder direktdemokratische Abstimmungen. Demokratie-Innovationen reichen von participatory budgeting über BürgerInnen-Räte bis hin zu neuen Methoden der Interaktion. Sie können sich mehr um den Input drehen, also um die Prozesse der Entscheidungsfindung. Sie können aber auch den Output betreffen, sich also in Gesetzen äußern, die etwa mehr Chancengleichheit herstellen und soziale Ungerechtigkeiten abbauen. Schließlich können sie sich auch auf politische Kommunikation beziehen, wenn man darunter mehr den Dialog versteht als Marketing und Inszenierung. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Was es braucht, sind gute Ideen und politischer Wille zur Umsetzung. Etwas genauer bin ich auf die Varianten demokratischer Innovationen in einem neu erschienenen Artikel eingegangen, der vor kurzem im italienischen Fachjournal Comunicazione politica auf Englisch erschienen ist: https://www.rivisteweb.it/doi/10.3270/84679
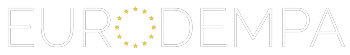
 Deutsch
Deutsch